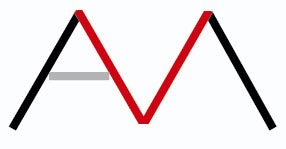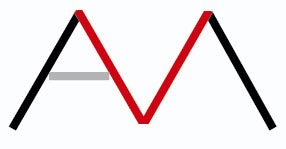|
Editorial
zur Edition Cyberculture Studies:
Da die
kulturwissenschaftlichen Beiträge (Cultural
Studies)
zur Cyberkultur ursprünglich und quantitativ vor allem aus
Amerika kamen und kommen und sich für diese immer noch in
Entstehung befindliche Forschungsrichtung der englische Name
etabliert hat, haben wir unsere Publikationsreihe mit
Cyberculture
Studies überschrieben.
David
Silver, der Media
Studies an
der Universität von San Francisco lehrt und der von 1996 –
2009 das Resource
Center for Cyberculture Studies (RCCS) leitete,
differenzierte nach den ersten beiden Forschergenerationen der
Cyberculture
Studies seit
den Ende 90ern eine „dritte Generation“, die er
„Critical
Cyberculture Studies“ nannte
und die „das Feld nicht mehr nur auf bloße virtuelle
Gemeinschaften und Online-Identitäten beschränken.“
Das Forschungsfeld wurde seither auch um soziale, kulturelle,
ökonomische und politische Dimensionen und Intersektionen
erweitert. Doch die
Perspektivenerweiterungen der nächsten Generation(en)
entwickelte und entwickelt sich beschleunigend weiter. So sind
immer mehr neue Forschungsfelder und -perspektiven dazugekommen,
wie z.B. religionswissenschaftliche, ethnologische,
ethnomedizinische, etc. und die Zukunft liegt eindeutig in den
auch höhen- und tiefenanthropologisch fundierten Integral
Cyberculture Studies.
Die
Kernfrage, der diese Studienreihe nachgehen möchte, lautet:
Was sind die wichtigen Wesenszüge der sich rasant
entwickelnden Cyberkultur – einer kybernetisch
evolvierenden, telematisch vernetzten und kosmopolitisch sich
einenden Menschheitskultur im heutigen 21. Jahrhundert? Wenn die
Cyberculture
Studies vor
allem hypermoderne kulturelle Selbstreflexionen darstellen, wird
dieser Prozess der diesbezüglichen Perspektivenerweiterungen
mit den regelrechten Wissensexplosionen in so vielen
Teildisziplinen immer weiter fortschreiten. Diesem Prozess der –
auch unkonventionellen – Selbstbeobachtung der
Cybergeneration ist diese Publikationsreihe gewidmet. Hier sollen
interessante und innovative neue Positionen der Cyberkultur
vorgestellt und dabei ggf. auch neue ästhetische Wege der
Vermittlung beschritten werden.
Der
Edition
Cyberculture Studies liegt
ein weites und letztlich integrales Kulturverständnis
zugrunde, sowie ein „Cyber“-Begriff, der neben der
informationstechnischen Konnotation auch stark das Kybernetische
(in evolutionären Prozessen) mit meint. Somit schießt
der Signifikant „Cyber“ einerseits an die alte antike
Steuermannskunst (vom griechischen kybernetike)
an, von der auch schon Platon sprach und die ganz allgemein das
bewusste Steuern von Prozessen im Hinblick auf das Erreichen
eines Telos, eines Ziels bzw. Sollwerts bedeutet. Anderseits
weckt das Präfix „Cyber-“ im heutigen 21.
Jahrhundert klar computer-, internet- und netzwerk-bezogene
Assoziationen und ist gerade durch den sich immer weiter
beschleunigenden Prozess der digitalen Revolution hypermodern. In
diesem weiten Begriffsverständnis und Spannungsfeld bewegen
sich die Cyberculture
Studies:
zwischen kybernetischer Anthropologie und Cyberspace-Forschung –
zwischen intelligenter Navigations- und Steuerungskompetenz und
virtuellem Reality-Design.
Band 1: Boris
N. Hiesserer: ECCE PANIS ANGELORUM – DAS BROT DER
ENGEL
Heilige Technologien Visionärer Kultur
Das Buch ECCE
PANIS ANGELORUM des Herausgebers, Autors, Medienkünstlers
und -Schamanen Boris N. Hiesserer eröffnet diese neue Reihe
mit einem außergewöhnlichen Forschungsdokument zur
Kulturgeschichte der Psychedelik im allgemeinen und des
Mutterkorns im besonderen. Das Werk unter die Überschrift
„Cyberkultur und Drogengebrauch“ zu stellen, würde
sicherlich in vielfacher Hinsicht zu kurz greifen, geht es
Hiesserer doch vor allem um eine Sicht auf psychoaktive
Substanzen als Psychedelika
und Entheogene.
So wird gerade durch seine Studie deutlich, dass ein
undifferenzierter Drogenbegriff mehr verschleiert als zur Klärung
von realen Zusammenhängen hilft. Das Buch ist trotz seines
Fokus auf die psychoaktiven Substanz des Mutterkorns, aus dem
Albert Hofmann 1943 sein „Sorgenkind“ und
potenzielles „Wunderkind“ LSD synthetisierte, vor
allem ein Beitrag zur psychedelischen Bewusstseinsforschung.
Veränderte Bewusstseinszustände (VBZ) sind, wie die
moderne Ethnologie gezeigt hat, über Jahrtausende und
kulturelle Grenzen hinweg wichtiger Teil der Menschheitskultur
und könnten sogar ein wesentlicher Faktor in der
Evolutionsgeschichte des Menschen sein. Die Zugänge zu
psychedelischen, d.h. die Seele offenbarenden Erfahrungen in
außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen, sind
zumeist stark rituell kodifiziert, kontextualisiert und kulturell
vielfältig. So werden mögliche Trance-, Ekstase- oder
Flow-Erfahrungen z.B. durch rituelles Tanzen, Musizieren,
Meditieren, Fasten aber auch durch die Einnahme psychoaktive
Substanzen, wie Pilze, Kakteen anderer botanischer Schätze
der Natur, eröffnet. Die Psychedelik ist somit die
Erfahrungswissenschaft veränderter Bewusstseinszustände
(VBZ oder ASC für Altered
States fo Consciousness)
und neben den Zugangsmethoden, sowie dem
ethno-neuro-psycho-pharmakologischem Grundlagenwissen, geht es
hierbei auch ganz zentral um die Erfahrungs- und Prozesskompetenz
– die Psychonautik,
d.h. die subjektive Fähigkeit mit diesen außergewöhnlichen
Zuständen sinnvoll, d.h. entwicklungsfördernd,
lebensbereichernd, alltagsintegrativ, ja sogar heilbringend
umzugehen. Abgesehen von den vielen interkulturellen Zeugnissen
diesbezüglicher schamanischer Heilarbeit hat auch die
‚westliche’, naturwissenschaftlich orientierte
Medizin die Heilungspotenziale veränderter
Bewusstseinszustände zum Teil schon erkannt. So sprach z.B.
der deutsche Psychiater, Begründer der Psycholytischen
Psychotherapie und Gründer des Europäischen
Collegiums für Bewusstseinsforschung (ECBS)
Hanscarl Leuner (1919
- 1996) von einer „Heilung durch Religion“ bzw.
mystisches Erleben, die – im richtigen set
und setting
– durch den
bewussten Einsatz von Psychedelika wie LSD (vgl. Leuner:
Halluzinogene.
Psychische Grenzzustände in Forschung und Psychotherapie,
Bern 1981) nachhaltig gefördert werden kann. Der chilenisch
us-amerikanische Mediziner und Psychiater Claudio Naranjo
lieferte in seinem Werk Reise
zum Ich – Psychotherapie mit heilenden Drogen
(Fischer, Frankfurt
a.M. 1979; speziell im herausragenden ersten Kapitel „Alptraum
und Ekstase als heilende Kräfte“) eine sehr wertvolle
Analyse der Risiken und Potenziale der Psychedelischen
Psychotherapie für
einen umfassenden Heilprozess im Sinne einer „(Helden-)Reise
der Seele“.
Psychotrope Substanzen (Psychotropika) haben
sowohl große Licht- als auch potenzielle Schattenseiten und
wie Aldous Huxley auch aus eigenen Erfahrungen beschrieb, ist das
mögliche Spektrum der so geöffneten Pforten der
Wahrnehmung weit und reicht zwischen „Himmel und Hölle“.
Bei Psychedelika handelt es sich also um sehr potente und
potenzialreiche aber nicht ungefährliche Substanzen, deren
positive, entwicklungsförderliche Nutzung fundiertes Wissen,
praktisches Knowhow und gute Vorbereitung bedarf. Die Bandbreite
der Erfahrungsqualitäten reicht von der „angstvollen
Ichauflösung“ (Adolf Dittrich) und bei prädisponierten
Personen sogar möglichen substanzinduzierten Psychosen bis
hin zur mystischen Einheitserfahrung, transpersonalen Schaulogik
und experimentellen Theologie (vgl. z.B. das berühmte
„Karfreitagsexperiment“ von Walter Pahnke 1962). In
diesem Zusammenhang sei nur kurz darauf hingewiesen, dass der
Theologe und Religionswissenschaftler Rudolf Otto (1869 - 1937)
das Wesen des Göttlichen in seinem Werk Das
Heilige sowohl
als „Mysterium tremendum“ (Furcht auslösendes
Geheimnis) als auch als „Mysterium fascinosum“
(Entzücken auslösendes Geheimnis) bestimmt hat. Sowohl
für das Numinose als auch für die psychedelische
Erfahrung gilt beides zugleich: tremendum
et fascinans!
Wenn
hier von „Heiligen Technologien“ (Mircea Eliade),
„Technologien des Heiligen“ (Stanislav Grof) oder
„sakraler Droge“ (Albert Hofmann) die Rede ist, ist
eben diese spirituelle Dimension gemeint, die natürlich auch
einen sakralen Rahmen (set
& setting)
mit einschließt.
Für Eingeweihte des indischen
Tantrayana
und tantrischen Yoga
ist diese Doppelgesichtigkeit nichts neues. Im Tantrismus werden
schon seit alters her spirituell unorthodoxe Praktiken wie z.B.
ritueller Geschlechtsverkehr und der Gebrauch von Substanzen wie
z.B. soma
für den Yoga,
d.h. die Einung, mit dem Göttlichen verwendet, die jedoch
auf der Ebene des Sutrayana
als gefährlich
und sogar verderblich abgelehnt werden. Spätestens seit
Friedrich Nietzsche wissen wir mit Rückblick auf die alten
Griechen, dass es nicht nur den apollinischen Weg zum Göttlichen
gibt, sondern auch eine Weisheit des Dionysischen.
Diese
Studie möchte explizit nicht zum Konsum und Missbrauch von
Drogen anleiten oder anregen, sondern Impulse für einen
differenzierteren Diskurs zum Spezialgebiet der Psychedelik
geben. Die Psychedelik ist ein spezifischer Aspekt und eigener
Forschungszweig einer Integralen
Bewusstseinsforschung und
einer Cyberkultur des 21. Jahrhunderts, die mehr und mehr mit
ständig neuen Technologien und immer weiterentwickelteren
neuro- und psychotropen Substanzen – Stichwort:
Neuro-Enhancement – konfrontiert wird. Schon deshalb wird
man um eine zeitgemäß sachliche,
neuropsychopharmakologisch fundierte Differenzierung der
verschiedenen Substanzen und ihrer potenziellen Gefahren und
Nutzen nicht herum kommen. So plädiert beispielsweise der
renommierte Neurophilosoph und -ethiker Thomas Metzinger neben
der Forderung nach einer „neuartigen Bewusstseinskultur“,
wie z.B. Meditationsunterricht an Schulen, auch für die
„Einführung eines (allerdings nicht leicht zu
bestehenden) LSD-Führerscheins“. Die
interdisziplinären Diskussionen darüber werden weiter
an Dynamik gewinnen und überhaupt ist in den letzten Jahren
eine „Renaissance des Psychedelischen“ zu beobachten,
wie z.B. Paul-Philipp Hanske und Benedikt Sarreiter in ihre
Studie Neues von
der anderen Seite. Die Wiederentdeckung des Psychedelischen
(Suhrkamp, Berlin 2015) klar
herausgearbeitet haben und wie auch der große Erfolg von
Michael Pollan's Buch „How to Change your Mind“ (laut
der New York Times eines der 10 besten Bücher des Jahres
2018) zeigt.
Inspiriert durch seine Gespräche mit dem
kanadischen Medienphilosophen Marshall McLuhan hat Timothy Leary
selbst die Losung für die Zukunftsrichtung der Psychedelik
ausgegeben: „From Psychedelics to Cybernetics“ und so
schließt sich hier auch wieder der Kreis zwischen
psychedelischer und Cyberculture-Forschung.
Boris Hiesserers
unkonventionelles Forschungsdokument zur Kulturgeschichte der
Psychedelik und des Mutterkorns ist ein teilweise provokativer,
aber auch erfrischend visionär-innovativer und Denkgrenzen
sprengender Ansatz und ein bewusstseinsknalliger Impuls für
den weiteren cyberkulturellen Dialog…
|